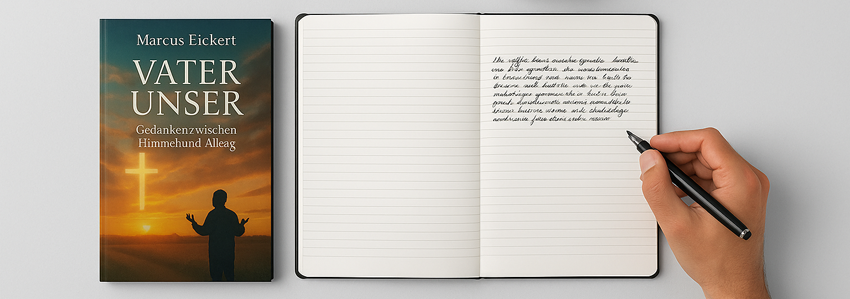Wenn ich ins Krankenhaus gehe, bin ich nicht der, der heilt. Ich bin nur der, der da ist. Einfach da – in einem Moment, wo andere fast alles verloren haben: Gesundheit, Sicherheit, Gewissheit. Ich gehe durch die langen Flure, setze mich ans Bett, höre zu. Und merke: Da passiert etwas. Nicht immer. Aber manchmal. Dann weicht für einen Augenblick die Angst, dann wird es still in der Seele, weil jemand da ist, der nicht wegläuft.
Ich bin nicht der große Tröster. Aber ich glaube daran, dass Trost sich ausleihen lässt. Von oben. Wenn ich einem Menschen die Hand halte und mit ihm ein Vaterunser bete, dann leihe ich mir Worte, die schon viele vor uns getragen haben – durch dunkle Täler. Es ist ein erstaunliches Leihgeschäft, das da stattfindet: Ich gebe meine Zeit, meine Gegenwart. Und bekomme dafür etwas zurück, das man nicht planen kann – einen Moment geteilten Glaubens vielleicht. Oder ein stilles Nicken, das sagt: Jetzt ist es ein bisschen leichter.
Es ist erstaunlich, wie viele Menschen gerade dann wieder anfangen zu glauben, wenn es eng wird. Im Alltag war Gott oft weit weg. Aber im Krankenbett, da rückt er auf einmal ganz nah. Manchmal nur als Frage: Warum ich? Manchmal als Bitte: Bleib bei mir. Und manchmal als stille Ahnung: Ich bin nicht allein. Ich denke dann oft an Psalm 23. Nicht, weil ich ihn so oft zitiere, sondern weil ich ihn dort gespürt habe, zwischen Tropfständern und Visite. „Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal…“ – dieser Satz hat schon viele gehalten, wo kein anderer Halt mehr war.
Ich begegne Menschen aus aller Herren Länder. Unterschiedlich in Hautfarbe, Sprache, Religion. Aber in der Not sind sie sich ähnlich: verletzlich, sehnsüchtig, dankbar für jedes offene Ohr. Ich habe gelernt: Jeder Mensch hat eine Geschichte, die es wert ist, erzählt zu werden. Und wer hinhört, wird reich beschenkt. Nicht materiell. Aber innerlich. Ich gehe oft nach Hause mit einem neuen Blick auf das Leben. Und einer Ahnung von dem, was zählt.
Ich bin nicht der, der alles weiß. Und schon gar nicht der, der mit Antworten glänzt. Aber ich bin der, der Fragen aushält. Und der versucht, seinem eigenen Glauben treu zu bleiben – auch wenn er manchmal leise ist. In jedem Gespräch mit einem Kranken wird mir bewusst: Ich brauche selbst Halt. Und der kommt nicht aus mir. Der kommt von dem, der gesagt hat: „Siehe, ich bin bei euch alle Tage…“ (Matthäus 28,20). Auch im Krankenzimmer. Auch im Abschied.
Die Seelsorge in der Klinik ist kein Job. Es ist eine Berufung. Und es ist ein Ort, an dem ich das Evangelium mit Händen greifen kann. Nicht theoretisch. Sondern ganz konkret. Da, wo Menschen weinen, hoffen, glauben, zweifeln. Und ich mittendrin. Leihweise. Für einen Moment.